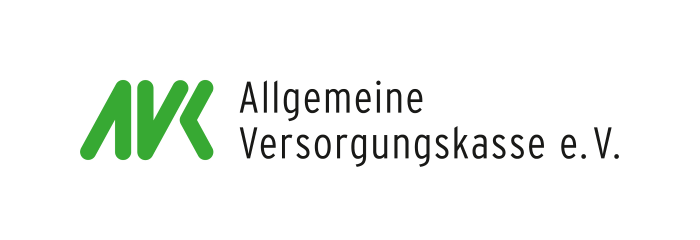Was ist neu bei Ehescheidung?
Im Jahre 2009 ist das Scheidungsrecht mit dem Versorgungsausgleichsgesetz grundsätzlich reformiert worden. Der sogenannte Versorgungsausgleich regelt bei einer Scheidung die Teilung von Versorgungsanrechten auf Rente im Alter oder bei Invalidität mit dem Ziel einer gleichwertigen Teilhabe. Mit der Neuregelung soll bereits bei der Scheidung eine abschließende Klärung der Versorgungsansprüche herbeigeführt werden.
Bei Versorgungsanwartschaften aus betrieblicher Altersversorgung sind sowohl Rentenansprüche als auch Anwartschaften auf Kapitalzahlungen auszugleichen. Dabei fordert das zuständige Familiengericht den jeweilig verantwortlichen Versorgungsträger (z. B. den Arbeitgeber oder die Deutsche Rentenversicherung u. ä.) auf, für die ausgleichspflichtigen Person eine Versorgungsauskunft zu erteilen. Diese Versorgungsauskunft beinhaltet die in der Ehezeit erdienten Versorgungsanwartschaften – den sogenannten Ehezeitanteil. Die Hälfte davon ist regelmäßig der Leistungsanspruch für die ausgleichsberechtigte Person, der sogenannte Ausgleichswert.
Was unterscheidet die externe von der internen Teilung und wer entscheidet dies?
Bei der internen Teilung als Regelfall wird die ausgleichsberechtigte Person ebenfalls beim bisherigen Versorgungsträger mit den hälftigen Anwartschaften aufgenommen. Sie erhält dazu den Status eines mit unverfallbaren Anwartschaften ausgeschiedenen (fiktiven) Mitarbeiters. Wichtig dabei zu berücksichtigen ist, dass der Arbeitgeber des Ausgleichspflichtigen zugleich stets auch für diese – regelmäßig betriebsfremde – Person alle Verpflichtungen nach dem Betriebsrentengesetz und damit insbesondere auch die Haftung für die Erfüllung dieser betrieblichen Versorgungsanwartschaften übernimmt.
Alternativ kann der Versorgungsträger dem Familiengericht auch die Wahl eines sogenannten externen Versorgungsausgleichs mitteilen und muss dazu den maßgeblichen Kapitalbetrag für die gleichwertige Neubegründung einer Versorgungsanwartschaft übermitteln. Sofern hier die im Gesetz bestimmten Höchstgrenzen überschritten sind, muss die ausgleichsberechtigte Person ausdrücklich einer externen Teilung zustimmen. Sie hat nun allerdings auch das Recht, selber einen geeigneten Zielversorgungsträger auszuwählen. Welche Zielversorgungsträger für die externe Teilung überhaupt geeignet und zulässig sind, regelt das Versorgungsausgleichsgesetz.
Welche Nachteile weisen die bisherigen Zielversorgungsträger bei der externen Teilung auf?
Sofern die ausgleichsberechtigte Person bei externer Teilung keinen Zielversorgungsträger auswählt, der einer Aufnahme zustimmt, hat der Gesetzgeber als eine Art „Auffanglösung“ mit eigenem gesetzlichen Rahmen die sogenannte Versorgungsausgleichskasse (VA-Kasse) bestimmt bzw. alternativ die gesetzliche Rentenversicherung.
Die VA-Kasse stellt nach den Bestimmungen des Betriebsrentenrechts eine Pensionskasse dar, die von einem Konsortium von über 30 Versicherungsunternehmen gegründet wurde. Sie darf keine Abschlusskosten verrechnen und muss in den Tarifen zwingend den aktuellen Höchstrechnungszinssatz für Versicherungen verwenden (dieser beträgt in 2021 noch 0,9 % und ab 2022 vorr. nur noch 0,25 %.). Das schränkt natürlich die aus dem Übertragungskapital finanzierbaren Rentenleistungen stark ein.
Darüber hinaus gibt es auch keine Hinterbliebenenleistung. Bei Tod vor Rentenbeginn wie auch in der Rentenzeit erlöschen alle Versorgungsansprüche.
Eine Abfindung oder Kapitalisierung ist ebenfalls ausgeschlossen, als Versorgungsleistung kommt also nur eine lebenslange Altersrente infrage. Ebenso gibt es keine zugesicherten Rentensteigerungen. Ein Inflationsausgleich bei den Altersrenten ist nur dann möglich, wenn in dem Konsortium tatsächlich Überschüsse erwirtschaftet werden.
Was hat sich mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 26.05.2020 geändert?
Das Bundesverfassungsgericht hat nach etwa zehn Jahren die Praxis neuen Versorgungsausgleichsrechts überprüft. Bis dahin genügte es in der Praxis den Familiengerichten, wenn der vorgeschlagene Versorgungsträger dem Grunde nach zulässig war, egal wie gut oder schlecht die aus dem Übertragungskapital finanzierten Rentenanwartschaften letztendlich waren. Analysen haben ergeben, dass nahezu 95 % der Ausgleichsberechtigten weiblich sind und die insbesondere aus den vermittelten Riester-Renten oder Rürup-Renten der Privatwirtschaft regelmäßig die Hälfte der Altersrenten erhielten, die ihnen bei internem Ausgleich zugestanden hätten. Das Bundesverfassungsgericht hat nun eine Verschlechterung (sogenannte Transferverluste) von maximal 10 % als (noch) angemessene Teilhabe beim Versorgungsausgleich bestimmt.
Anderslautende Angebote wären verfassungswidrig und entsprechend durch das Familiengericht gegebenenfalls durch Aufstockung des Übertragungskapitals zu korrigieren.
In der Folge ist der Versorgungsausgleich für viele Versicherungsvermittler nicht mehr attraktiv und auch die privaten Rentenanbieter ziehen sich mehr und mehr aus diesem Geschäft zurück. Das ist die Zeit und Chance für völlig neue Produkte und Marktteilnehmer.
So taucht mit dem AVK erstmals in Deutschland eine Unterstützungskasse als zulässiger Zielversorgungsträger auf, die ohne Versicherungstarife mit wirklich garantierter Verzinsung deutlich höhere Renten und Versorgungsleistungen anbieten kann, deren Entwicklung bis zum Rentenbeginn und anschließend lebenslange Leistungserbringung nun auch eine völlig neue Qualität der Sicherheit gewähren kann.